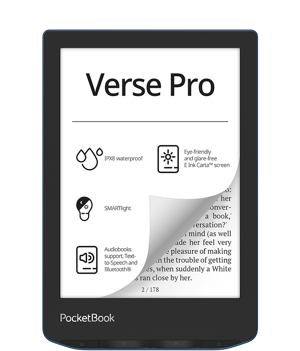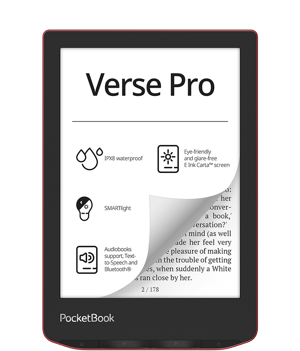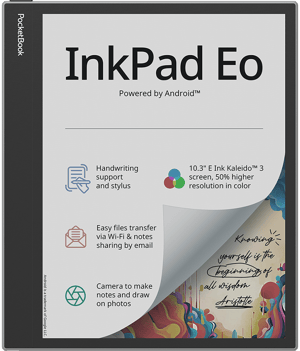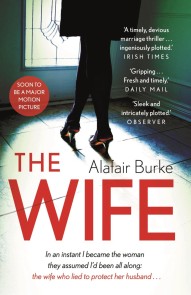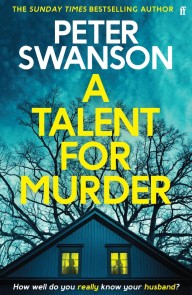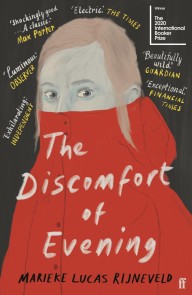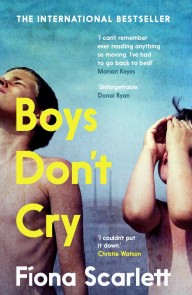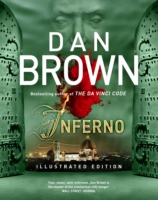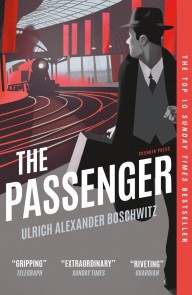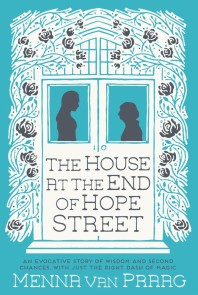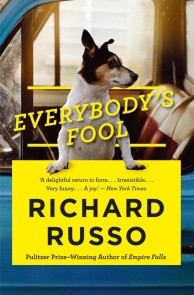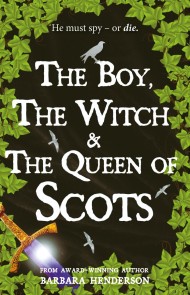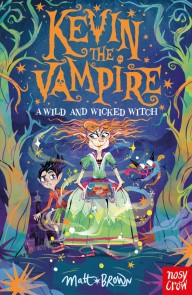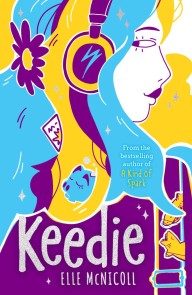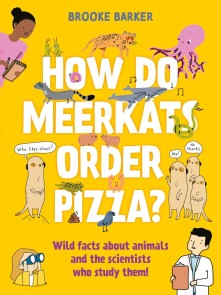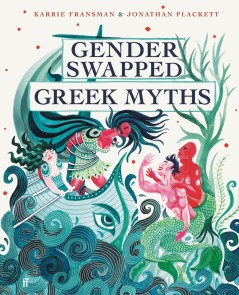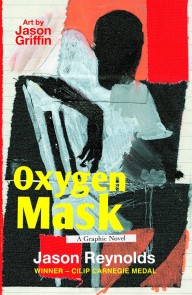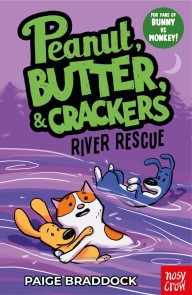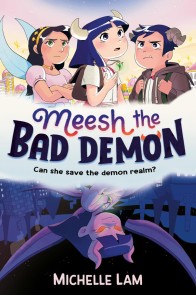PocketBook Shop - Buy eReaders, eNotes, eBooks, Audiobooks, and Accessories Online.
Choose your PocketBook
- New
 Pre-order. Era Color: fashion edition with Karl Lagerfeld coverproduct_type_E-readersPrice0269,00 €
Pre-order. Era Color: fashion edition with Karl Lagerfeld coverproduct_type_E-readersPrice0269,00 €
Book of the day
They say boys don't cry.
But Finn's seen his Da do it when he thinks no one's looking, so that's
Price
11,99 €
Price
11,99 €